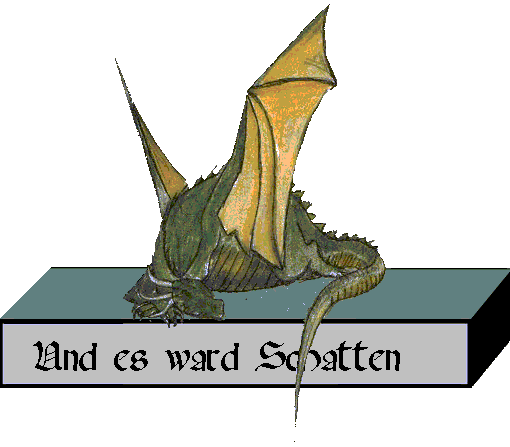Kapitel 11
Erzählt von Severus Snape:
Ich stand im Wohnzimmer der Anpheras. Vor mir auf dem Boden knieten Vanessa und ihre Tochter, umringt von Todessern und starrten mich mit weit aufgerissenen Augen an.
„Töte sie!“, hatte Voldemort mir soeben mit kalter Stimme befohlen und ich trat vor.
Ich näherte mich langsam der Frau. Als ich sie fast erreicht hatte, zögerte ich.
Ich konnte das nicht tun. Ich konnte nicht sie umbringen! Sie kannte mich, war mit meiner Frau befreundet. Und ich kannte ihren Mann. Wie konnte ich nun seine Familie auslöschen?
Sie bemerkte mein Zögern und schrie mich an: „Tu es endlich! Oder bist du so von meinem Anblick gefangen, daß du es nicht über`s Herz bringst, mich zu töten? Dann wird es ein anderer tun! Also nun tu es endlich! Töte mich!“
Ich wußte, daß sie mich erkannt hatte. Sie wußte Bescheid über meine Tätigkeit im Auftrag Dumbledores und nun opferte sie sich, um meine Tarnung aufrecht zu erhalten.
Ich bewunderte den Mut dieser Frau, die nicht um ihr Leben bettelte. Mir war klar, daß ich es tun mußte, also ging ich zu ihr und richtete meinen Zauberstab auf ihren Kopf.
Vanessa schloß die Augen.
„Avada Kedavra!“, sagte ich mit so emotionsloser Stimme, wie ich konnte und sie sackte tot zusammen.
Dann wandte ich mich an das Kind, das mich erstaunt ansah. Auch diesen Menschen tötete ich mit einem Wink meines Zauberstabes.
Voldemort und die anderen Todesser verließen den Raum und ich riss mich mühsam zusammen, um ihnen zu folgen. In der Wohnzimmertür angekommen, drehte ich mich noch ein letztes Mal zu den beiden Menschen, die ich gerade getötet hatte, um und erstarrte.
Dort, wo eben noch Vanessa Anphera mit ihrem Kind gelegen hatte, lagen nun Soleya und Judy leblos auf dem Boden.
Das konnte doch nicht sein! Ich hatte meine eigene Familie getötet?
„Nein!“, schrie ich verzweifelt und stürzte zu ihnen hinüber.
Ein lauter Schrei riß mich aus dem Schlaf. Wer hatte da geschrien?
Plötzlich wurde mir klar, daß außer mir niemand hier unten in den Kerkern war, und ich es also gewesen sein mußte der geschrien hatte. Dann erinnerte ich mich an den Traum.
Ich hatte meine eigene Familie umgebracht!
„Es war nur ein Traum“, versuchte ich mich selbst zu beruhigen.
Aber das war es nicht. Es war wirklich geschehen. Ich hatte Soleya und Judy getötet. Zwar nicht eigenhändig, wie in dem Traum, doch indirekt.
Indirekt hatte ich sie auf dem Gewissen.
Ich schloß meine Augen, in der Hoffnung, der Schlaf würde erneut über mich kommen und mich von diesen Gedanken erlösen, doch er kam nicht.
Mein Nachthemd war schweißdurchtränkt und klebte unangenehm an meinem Körper. Eine Weile noch verharrte ich so, dann stand ich seufzend auf, wobei sich mein Kopf in schmerzlicher Weise bemerkbar machte. Ich wartete einen Moment, bis das Pochen ein wenig nachließ, dann ging ich in das Bad, das sich an mein Schlafzimmer anschloß. Während mir das erfrischende Duschwasser über die Haut strömte versuchte ich krampfhaft meine Gedanken auf neutrale Dinge, wie das nahende Mittagessen zu lenken. Doch es gelang mir nicht. Unaufhaltsam drängte sich mir das Bild meiner toten Familie im Wohnzimmer der Anpheras auf. Die Augen erstaunt aufgerissen, schienen sie mir vorwurfsvoll entgegen zu blicken.
Hastig verließ ich das Badezimmer und zog mich an. Dann richtete ich meinen Zauberstab auf meine Haare und murmelte einen einfachen Spruch, der meine Haare in einigen Sekunden trocknete. Das fettige Aussehen blieb. Ich besaß ein Shampoo, das mein Haar davon wenigstens teilweise befreite, doch ich hatte es nicht hier. Es stand in meinem Haus. Dem Haus, das einmal unser Heim gewesen war. Unser. Verzweiflung stieg in mir hoch.
Ich mußte mich irgendwie ablenken. Die alles erdrückenden Gedanken abschütteln.
Ich ging hinüber in mein Büro. Mein Schreibtisch war bedeckt von Weinflaschen. Verschwommen erinnerte ich mich daran, daß ich hier gestern abend nicht alleine gesessen hatte.
Ich war mir nicht sicher, nahm aber an, daß Lupin bei mir gewesen war. Er kam öfters hier zu mir in die Kerker, um mit mir zu reden oder einfach nur um gemeinsam etwas zu trinken. Hoffentlich hatte ich ihm nichts erzählt, das ich im nüchternen Zustand lieber für mich behalten hätte.
Was sollte ich nun tun? Nach dem Stand der Sonne zu urteilen, war das Frühstück bereits beendet. Wäre ich sonst hingegangen? Wahrscheinlich nicht.
Aber ich mußte etwas tun, also beschloß ich, aufzuräumen. Mein Büro hatte es nötig. Zuerst warf ich die leeren Flaschen in den Mülleimer, dann räumte ich die wenigen Vollen in den dafür vorgesehenen Schrank. Anschließend nahm ich die zwei dreckigen Gläser und reinigte sie mit einem Spruch.
Was nun? Wieder stand ich unschlüssig in der Mitte des Raumes und überlegte, was ich als nächstes machen könnte, um mich zu beschäftigen. Vielleicht hätte ich die Gläser mit der Hand reinigen sollen. Das hätte um einiges länger gedauert.
Hilflos ging ich hinüber zu meinem Schreibtisch und setzte mich. Sofort wanderten meine Gedanken zurück zu dem Traum.
Ich hatte sie wirklich getötet. Meine Familie. Alles, was ich hatte. Ich hatte sie verloren.
Verloren? Nein, ich hatte sie nicht verloren, ich hatte sie mir nehmen lassen. Hatte dafür gesorgt, daß sie mir genommen wurden.
Ich hätte den Auftrag Dumbledores abgeben müssen, als ich Soleya heiratete, denn in diesem Augenblick hatte ich eine Verantwortung ihr gegenüber übernommen. Später auch die für Judy. Für ihre Sicherheit. Doch ich hatte sie nicht erfüllt. Ich hatte versagt.
Eine unendliche Schwere bemächtigte sich meines Körpers.
Ich hätte damit rechnen müssen, daß Voldemort meine Familie als Druckmittel benutzen würde, oder um mich zu bestrafen. Aber ich hatte diese Möglichkeit nie gesehen, hatte nie an die drohende Gefahr gedacht. Und diese Dummheit, meine Dummheit, mußten Soleya und Judy mit dem Leben bezahlen. Ich war Schuld an ihrem Tod.
Ich trug die Schuld dafür, die einzigen Menschen, die ich jemals wirklich geliebt hatte und die mich ebenfalls geliebt hatten, nun tot waren.
Sie hatten mein Leben lebenswert gemacht, hatten mir gezeigt, was es bedeutete glücklich und unbeschwert zu sein. Zu leben.
Die Zeit, mein Leben, bevor ich Soleya traf war erfüllt gewesen von Dunkelheit. Von Haß und Verbitterung.
Soleya hatte Licht in mein Leben gebracht und mir zwei Jahre voller Zufriedenheit geschenkt. Zwei Jahre lang hatte ich ein wirklich schönes Leben geführt. Die erste schöne Zeit, die ich erlebt hatte.
Und nun war sie zu Ende und es würden die einzigen schönen zwei Jahre bleiben. Da war ich mir sicher. Ohne meine Familie würde ich zurückfallen in mein altes, dunkles Leben und niemals wieder heraus finden. Ich würde für immer darin versinken.
Wollte ich noch einmal solch ein Leben führen? Konnte ich das? Durfte man so etwas überhaupt als Leben bezeichnen?
Ich öffnete die mittlere Schublade meines Schreibtisches und blickte auf die darin liegenden Messer.
Es waren die Messer, mit denen die Zutaten für die Tränke zerkleinert wurden. Ich bewahrte sie in meinem Büro auf, um den Schülern den Zugang darauf zu erschweren.
Langsam nahm ich eines der Messer aus der Schublade und fuhr mit meinem Daumen über die Klinge. Sofort begann Blut aus dem Schnitt zu strömen. Nachdenklich preßte ich meinen Zeigefinger auf die Wunde.
Ich hatte meine Familie getötet. Sie waren an meiner Stelle gestorben und ich hatte kein Recht, weiter zu leben. Und ich wollte es auch nicht. Ich wollte nie wieder ein solches Leben führen, wie ich es Jahre, Jahrzehnte, lang getan hatte.
Nein, das wollte und konnte ich nicht. Und es gab nur einen einzigen Ausweg, diesem zu entgehen.
Langsam schob ich meinen linken Ärmel bis zum Ellenbogen hoch. Das Dunkle Mal hob sich kontrastreich von meiner Haut ab.
Auch das würde nun ein Ende haben. Endlich, nach so langen Jahren der Schmerzen und seelischen Qualen.
Bedächtig setzte ich die scharfe Klingenspitze auf meine bleiche Haut am Handgelenk, dann ritzte ich mir langsam längs meines Unterarmes die Pulsader auf. Sofort begann helles Blut stoßweise aus dem Schnitt zu fließen.
Anschließend nahm ich das Messer in meine linke Hand. Sie begann leicht zu zittern und es dauerte einige Sekunden, bis ich sie wieder vollständig unter Kontrolle hatte. Dann schnitt ich auch an meinem rechten Handgelenk die Ader auf.
Es war geschafft. Ich ließ das Messer auf den Schreibtisch fallen und legte meine Hände ebenfalls vor mich auf den Tisch. Dann lehnte ich mich in meinen Stuhl zurück und starrte auf meine Arme. Das Blut lief an ihnen herunter und bildete allmählich dunkle Pfützen auf dem Holz.
Eine tiefes Gefühl der Ruhe überfiel mich plötzlich. Ich hatte es getan. Nun würde es bald endgültig vorbei sein. Mein sinnloses Dasein hatte endlich ein Ende.
Ich spürte, wie mich eine schleichende Schwäche überkam, während ich beobachtete, wie mein Blut, wie meine Lebensenergie, mich langsam verließ.
Zurück